
![[^]](icons/top.gif)
Vorbemerkungen
Als ich das erste Mal von der N-Maschine hörte, war ich
zunächst fasziniert, daß es so einfach möglich
sein sollte, einen "over unity"-Effekt zu erreichen.
Nach einem ersten "Küchentischexperiment" und dem
Studium diverser Quellen kamen mir verschiedene
Möglichkeiten in den Sinn um die Echtheit des Effektes und
die behauptete Rückwirkungsfreiheit zu überprüfen.
Dazu sollte zunächst eine N-Maschine aufgebaut und der
Effekt qualitativ erfaßt werden. Der Aufbau
müßte dann mechanisch und elektrisch optimiert und mit
einer entsprechenden Meßwerterfassung verbunden werden.
Zwei grundlegende Fragen wären dann
zu klären:
- Ensteht die Spannung an der
Leiterscheibe auch dann, wenn keinerlei feststehende Teile
mehr im Spiel sind (insbesondere die Abnehmerkontakte!)?
- Trifft, unabhängig von
der Antwort auf die erste Frage, die Behauptung von der
Rückwirkungsfreiheit zu?
Wenn die Antwort auf beide Fragen negativ ist, dann bedeutet
das, daß der N-Effekt kein echter Effekt ist, sondern ein
Trugschluß. Ist aber die Antwort auf nur eine der beiden
Fragen positiv, dann wäre eine gründliche Untersuchung
angebracht, denn dann liegt hier ein physikalisches Phänomen
vor, das der Theorie des Elektromagnetismus
zuwiderläuft.
Ich habe den Aufbau der N-Maschine im
Herbst des Jahres 1995 begonnen.
![[^]](icons/top.gif)
Mechanischer Aufbau
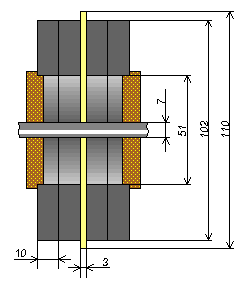 Ich habe mich
aus Material- und Kostengründen dafür entschieden, den
klassischen Aufbau dePalmas zunächst zu übernehmen. Als
Antrieb dient ein Gleichstrommotor 24V/25W mit Feldwicklung und
maximal 3000 U min-1. Die Permanentmagneten sind
Ringmagneten aus Bariumferrit, axial polarisiert (Fehrenkemper
Magnetsysteme, Maße siehe Zeichnung). Für die
Leiterscheibe verwende ich momentan 3 mm starkes Messing,
allerdings ist das eine Notlösung, da mir Cu-Blech mit einer
Stärke zwischen 3 und 5 mm nicht zur Verfügung stand.
Das Rotorpaket ist mit Zentrierstücken auf einer Stahlwelle
(Durchmesser 7 mm) befestigt, die mit der Leiterscheibe weich
verlötet ist. Die Welle ist kugelgelagert und mit der
Antriebswelle starr über einen Flansch gekoppelt. Die
gesamte Anordnung ist auf Al-U-Profil 50 x 120 x 4 mm aufgebaut.
Die Abnahme der Spannung erfolgt bei diesem ersten Aufbau
über Schleifkohlen mit einer Kontaktfläche von 3 x 7
mm, jeweils an der Stirnfläche der Leiterscheibe und direkt
an der Welle. Mit einem Optokoppler (Schlitzkoppler) wird ein
Drehzahlsensor realisiert, die Blende dafür ist direkt auf
der Motorachse befestigt. Die Elektronik des Sensors ist für
den Anschluß an eine RS232-Schnittstelle ausgelegt. Die
Anschlüsse des Motors und der Schleifkohlen sind auf
4-mm-Buchsen geführt, die isoliert auf das Al-Profil
montiert sind. Ich habe mich
aus Material- und Kostengründen dafür entschieden, den
klassischen Aufbau dePalmas zunächst zu übernehmen. Als
Antrieb dient ein Gleichstrommotor 24V/25W mit Feldwicklung und
maximal 3000 U min-1. Die Permanentmagneten sind
Ringmagneten aus Bariumferrit, axial polarisiert (Fehrenkemper
Magnetsysteme, Maße siehe Zeichnung). Für die
Leiterscheibe verwende ich momentan 3 mm starkes Messing,
allerdings ist das eine Notlösung, da mir Cu-Blech mit einer
Stärke zwischen 3 und 5 mm nicht zur Verfügung stand.
Das Rotorpaket ist mit Zentrierstücken auf einer Stahlwelle
(Durchmesser 7 mm) befestigt, die mit der Leiterscheibe weich
verlötet ist. Die Welle ist kugelgelagert und mit der
Antriebswelle starr über einen Flansch gekoppelt. Die
gesamte Anordnung ist auf Al-U-Profil 50 x 120 x 4 mm aufgebaut.
Die Abnahme der Spannung erfolgt bei diesem ersten Aufbau
über Schleifkohlen mit einer Kontaktfläche von 3 x 7
mm, jeweils an der Stirnfläche der Leiterscheibe und direkt
an der Welle. Mit einem Optokoppler (Schlitzkoppler) wird ein
Drehzahlsensor realisiert, die Blende dafür ist direkt auf
der Motorachse befestigt. Die Elektronik des Sensors ist für
den Anschluß an eine RS232-Schnittstelle ausgelegt. Die
Anschlüsse des Motors und der Schleifkohlen sind auf
4-mm-Buchsen geführt, die isoliert auf das Al-Profil
montiert sind.
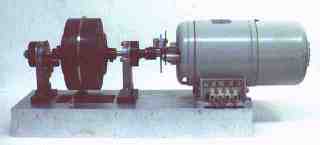
Der Aufbau ist in dieser Form
vorerst nur für den qualitativen Nachweis geeignet, evtl.
noch für die Aufnahme einiger Meßreihen. Für
Messungen unter Belastung, wie z.B. der Test der
Rückwirkungsfreiheit sind folgende Änderungen
nötig:
- Vergrößerung der Kontaktfläche
- Verwenden eines Materials mit geringerem spezifischen Widerstand für die Leiterscheibe (vorzugsweise Cu)
- eventuell Einsatz eines Joches, um den magnetischen Fluß zu verstärken
- Erhöhung der Drehzahl
Für den, der sich das ganze
noch genauer betrachten möchte, gibt es hier noch ein paar
Bilder dieser 1.Variante und die Schaltung des Sensors. Die Aufnahmen
wurden noch vor dem Einbau der Drehzahlmeßelektronik gemacht,
deswegen ist die Buchse für die V24-Schnittstelle noch nicht
mit drauf.
![[^]](icons/top.gif)
27.12.1996: Ein erster Test
Nachdem ich langezeit verhindert war, bin ich nun kurz vor
Ende des Jahres 1996 noch zur Fertigstellung der Elektronik und
der Software für die Messungen gekommen. Trotzdem ich mir
relativ klar darüber war, daß die Maschine bei weitem
nicht das Optimum darstellte, machte ich am 27.12.96, 11:00 einen
Probelauf. Das Ergebnis war, wie erwartet, etwas mager:
Bei 3000 U min-1 lieferte das oben
beschriebene 1. Modell eine Leerlaufspannung von 39 mV. Eine
Strom- und Leistungsmessung erübrigte sich bei dem
gegenwärtigen Aufbau wegen der für die geringe Spannung
zu großen Übergangswiderstände. Bei der Spannung
als Funktion der Drehzahl zeigte sich, wie erwartet, ein linearer
Verlauf.
| Drehzahl (U min-1) |
Spannung (mV) |
0
1000
2000
3000 |
0
13
26
39 |
|
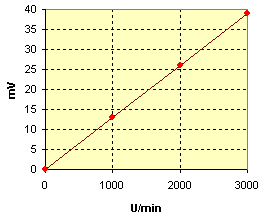 |
Da bei der Leerlaufspannung Übergangs- und
Innenwiderstände keine große Rolle spielen, scheint es
fast so, als ob dies das Maximum ist, das ich mit meinen Magneten
und der angegebenen Drehzahl erreichen kann. Falls nicht das
Material der Scheibe einen Rolle spielt, verhelfen mir
wahrscheinlich nur stärkere Magneten bzw. eine höhere
Drehzahl zu einer höheren Spannung.
Um den Einfluß der Feldstärke
auf die Spannung zu testen, habe ich die äußeren beiden
Magneten des Rotorpaketes entfernt. Ein Testlauf ergab, daß
die Spannung bei 3000 U min-1 in dieser Konfiguration nur 24 mV
erreicht. Zieht man in Betracht, daß sich die Stärke
des Feldes, das die Scheibe durchflutet, nicht genau halbiert,
wenn das Rotorpaket anstelle von 4 Magneten nur 2 enthält,
kann man zu dem Schluß kommen, daß sich die Spannung
proportional zur Feldstärke verhält. Für genauere
Messungen fehlt mir allerdings die Ausrüstung.
Hinsichtlich weiterer Messung sind, wie ich schon weiter oben
schrieb, Verbesserung notwendig, damit verwertbare Ergebnisse
zustandekommen. Einige davon sind schon in Arbeit: Eine neue
Leiterscheibe ist fast fertig und Schleifkontakte mit wesentlich
größerer Kontaktfläche (250 statt 21
mm2) sind schon da, brauchen aber noch entsprechende
Halterungen. Ein Problem ist noch der
"Zentrumskontakt", also der an der Welle. Weiterhin
gefällt mir nicht, daß die Leiterscheibe in den
Innenraum der Ringmagneten hineinreicht und dort vom Magnetfeld
in entgegengesetzter Richtung wie zwischen den Magneten
durchflutet wird. Ich könnte mir vorstellen, daß dies
eine Verringerung der Spannung verursacht. Ein paar konstruktive
Probleme sind also in nächster Zeit zu lösen.
![[^]](icons/top.gif)
05.01.1997: Umbauten - Das zweite Modell
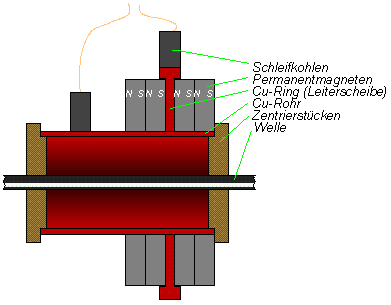
Nachdem der Effekt nun qualitativ nachgewiesen ist und ich
einen ersten Eindruck davon gewonnen habe, mache ich mich an den
Umbau des ersten Modells. Ich hatte weiter oben schon diverse
Unzulänglichkeiten aufgezählt, die genauere
Untersuchungen der Rückwirkung verhindern. Einige davon
werden in dieser neuen Variante meiner N-Maschine behoben. Dazu
gehören folgende Punkte:
- Die Kontaktfläche der Schleifkontakte wird
vergrößert: von 21 mm2 auf 250
mm2 pro Kontakt
- Die Leiterscheibe wird nicht mehr ins Innere der
Ringmagneten ragen
- Der innere Kontakt, der beim ersten Modell die Spannung
direkt an der Stahlwelle abgreift, bekommt durch das Cu-Rohr
eine größere Auflagefläche
- Das Material der Scheibe wird durch Kupfer ersetzt
Ob diese Umbauten eine Untersuchung der Rückwirkung
zulassen, wird sich allerdings erst nach der Fertigstellung und
einem neuen Testlauf herausstellen.Um eine Rückwirkung
messen zu können, müßte das Modell wenigstens
eine Leistung von 100 mW abgeben. Falls sich die Spannung durch
den Umbau nicht erhöht hat, ist dazu ein Strom von 2,65 A
notwendig. Ist der Innenwiderstand der Anordnung nicht niedrig
genug, hilft dann nur noch eine Erhöhung der Drehzahl, was
mit einem erneuten Umbau verbunden wäre.
![[^]](icons/top.gif)
08.03.1998: Schwierigkeiten
Mittlerweile ist mehr als ein
Jahr vergangen. Mehrmals wurde ich gefragt, ob sich an diesem
Projekt wiedermal was getan hat - und ich muß leider antworten:
Nein!
Zum einen liegt es daran, daß mir
mein Job kaum noch Zeit läßt und zum andern fehlen mir
auch einige Materialien für den Umbau des Modells. Ich habe
aber das Projekt nicht aus den Augen verloren und auch das
Interesse daran nicht. Es wird also auf alle Fälle eine
Fortsetzung geben...
![[^]](icons/top.gif)
14.04.2000: Relativbewegung ist notwendig!
Ich bin endlich wieder einmal dazugekommen, an dieser Sache
weiterzuarbeiten und einen mir sehr wichtigen Test durchzuführen.
Wie eingangs schon erwähnt, war
eine der Hauptfragen, ob die Spannung an der Leiterscheibe auch
ohne feststehende Abnehmerkontakte anliegt.
Diese Frage konnte ich nunmehr mit einem
eindeutigen Nein beantworten. Leider habe ich von dem
entsprechenden Aufbau kein Foto, die Beschreibung muß also
an dieser Stelle ausreichen: Ich habe einfach ein LCD-Panelmeter
mit einer Auflösung von 0,1 mV mit dem gesamten Rotorpaket
mitrotieren lassen und die Ablesung über ein Stroboskop
realisiert. Das Ergebnis war, wie ich auch erwartet habe,
negativ.
Schlußfolgerung: Die Spannung
entsteht offensichtlich in den Schleifkontakten selbst bzw.
wahrscheinlicher in dem Strompfad zwischen Zentrum und
Peripherie, wenn dieser gegenüber dem Magnetfeld bewegt
ist.
 |
 |
 |
 |
Die N-Maschine benötigt eine Relativbewegung zwischen
Leiterscheibe und Abnehmerkontakt, ansonsten entsteht keine
Spannung zwischen Zentrum und Peripherie der Leiterscheibe!
|
 |
 |
 |
 |
Damit dürfte die N-Maschine als "verkappte"
F-Maschine gelten, womit auch den Vermutungen hinsichtlich der
Rückwirkungsarmut oder sogar -freiheit der Boden entzogen
wird.
Gemessen habe ich dies allerdings noch
nicht. Schon der Vollständigkeit halber sollte also dieser Test
noch durchgeführt werden.
![[^]](icons/top.gif)
16.04.2001: Rotierender Strompfad
Ein Neuauflage des Versuchs vom 14.04.2001 soll nun endgültig
den Ursprung der Spannung klären. Das vorhandene Modell
wurde deshalb wie folgt umgebaut:
In die Leiterscheibe wurde im Abstand
von ca. 3 mm zur Außenkante ein umlaufender Spalt von ebenfalls ca. 3 mm
Breite gefräst, der mit isolierendem Epoxidharz ausgefüllt
wurde und mit dem Rest der Scheibe nur an einer Stelle leitend
verbunden ist. Damit ergibt sich zwangsläufig ein mit dem
System rotierender Strompfad, während die Bedigungen für den
Schleifkontakt unverändert bleiben.
Das Ergebnis bestätigte nicht nur den vorigen Versuch, sondern
stellt zugleich auch sicher, das die Quelle der Spannung - zumindest
zum Großteil - der gegenüber dem bewegten Magnetfeld des Rotors
stillstehende Leiter bzw. Strompfad) zwischen dem peripheren
Schleifkontakt und der Mittelachse ist.
|